Bücher: Rückblick 2024
Schon sehr früh habe ich eine unverähltnismäßig stark ausgeprägte Sorge entwickelt, dass unzählige meiner schönsten Erlebnisse im schwarzen Loch meines schlechten Gedächtnisses verschwinden würden, was ja einer gewissen Art von Verschwendung gleichkäme. Um dem entgegenzuwirken habe ich mehrere Strategien überdacht, nicht zuletzt versuche ich mich damit zu beruhigen, dass selbst wenn man sich nicht bewusst an etwas erinnert, so ist unbewusst doch jedes Erlebnis Teil seiner Gesamtsubstanz, und so leben die Einflüsse des Erlebten für immer in uns fort, formen uns mit, verdampfen nicht ungenutzt in der Leere.
Eine weniger esoterische und pragmatische Strategie zur Beruhigung, ist, das Erlebte aufzuschreiben. Ob man selbst, wie bei einer Kiste alter Fotobücher, je wieder dazu kommt, so tief in eigene Erinnerungen eintauchen zu wollen, sei dahingestellt, doch das Aufschreiben gibt einem zumindest das Gefühl, das die zu Papier (oder Pixeln) gebrachten Dinge nicht verloren sind, dass die Worte sie irgendwie in unserer stofflichen Welt halten und nicht loslassen, sodass sie in unendliche Fernen davonfliegen.
Um meine überdramatisierte Einleitung einmal kurzzufassen: im Folgenden möchte ich (in unbestimmter Reihenfolge) etwas zu fünf Büchern schreiben, die ich vergangenes Jahr gelesen habe, und die mir besonders in Erinnerung geblieben sind.
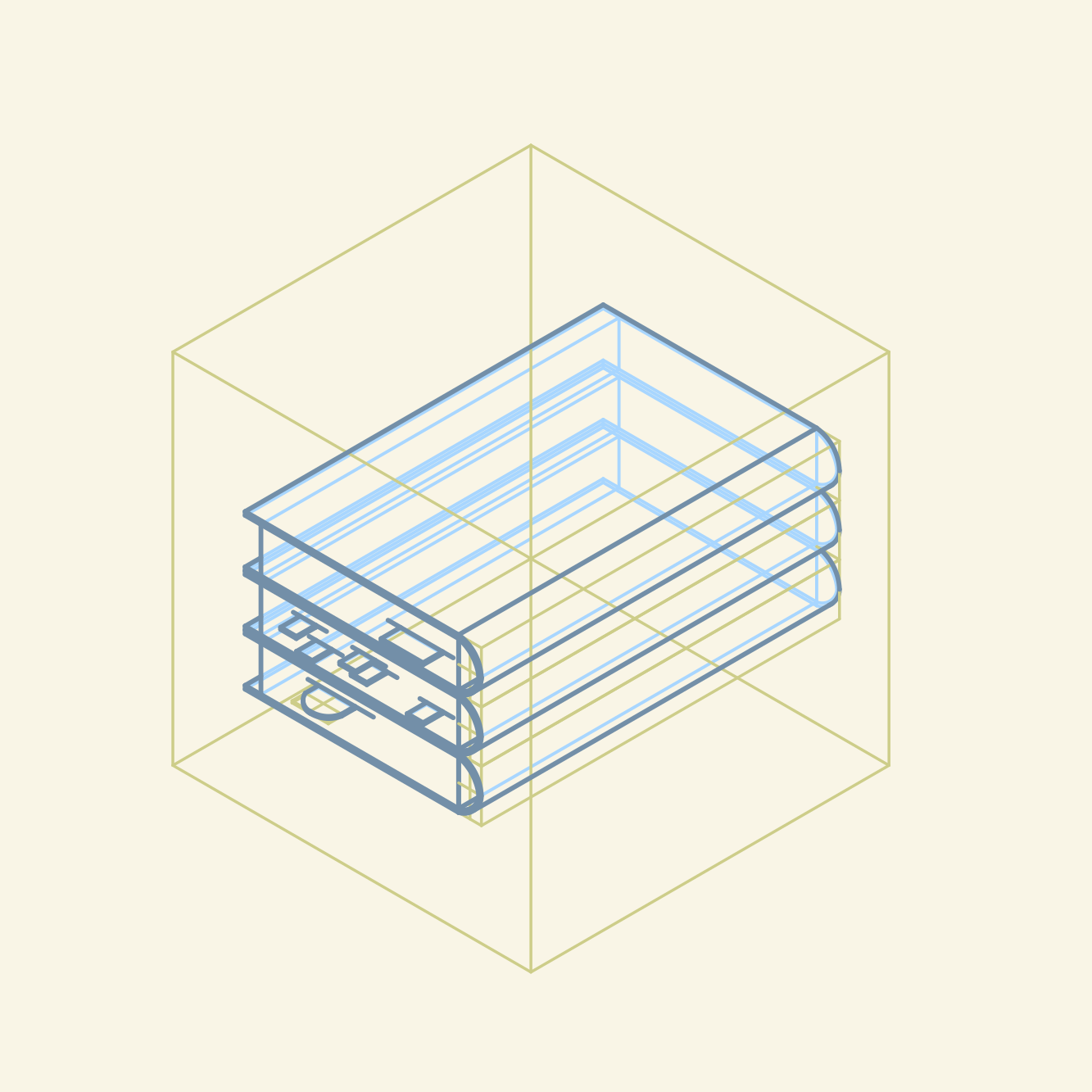
Pale Fire - Vladimir Nabokov
Sofern ich mich nicht irre, habe ich das erste und einzig andere Buch, das ich von Nabokov gelesen habe, im Sommer 2023 gelesen. Selbstredend handelte es sich dabei um Lolita, nicht nur Nabokovs wohl bekanntestes Werk, sondern auch ein Buch, das eine beinahe beispielslose Welle an Diskussionen, Fehlinterpretationen, Missverständnissen und Kontroversen ausgelöst hat, die bis heute anhält. Unlängst wurde ich auf einer Party gefragt, worum es in dem Buch gehe, nachdem ich so begeistert davon gesprochen hatte - die nach kurzem Zögern sich doch erfolgreich von meinen Lippen gelöste Antwort "...um einen Pädophilen..." war mir dann doch unangenehmer, als erwartet. Ganz im Einklang mit der Pedanterie Nabokovs, versuchte ich mich im Nachhinein zu beruhigen, dass die Unkenntnis meines Gegenüber mir diese Antwort überhaupt erst abverlangt hat, und diese Unkenntnis eigentlich schon von fehlender literarischer Bildung meiner Gesprächspartnerin zeugte, die ja peinlicher sein sollte als mein Erklärungsversuch. Dieser Beruhigungsversuch war nicht allzu wirksam.
Ich bin kein großer Verfechter von Vorworten oder Klappentexten, ich weigere mich prinzipiell mir ein Werk, dem ich meine Aufmerksamkeit schenken möchte, von jemandem vorkauen zu lassen. Ganz besonders verstörend wird es, wenn besagtes Vorwort oder ein ähnlicher Text sich auf einmal den absoluten Wahrheitsanspruch in seiner Deutung des vorliegenden Werks erdreisten möchte. In dieser Ansicht stimmt mir, man erlaube mir diese vorsichtige Deutung, Nabokov selbst zu, wie ich einem Nachwort (großer Unterschied zu einem Vorwort!) entnehmen konnte. Diese Einstellung allerdings führte zu einem peinlichen Missverständnis: das Vorwort in Lolita ist fiktiv und gehört zum Gesamtkunstwerk, und ich habe es, benebelt von meiner intellektuellen Überheblichkeit, natürlich übersprungen. Den gleichen Fehler wollte ich bei meinem nächsten Roman von Nabokov nicht begehen.
Pale Fire besteht aus einem Vorwort, einem Gedicht, und einem Kommentar zum Gedicht, wobei der vermeintliche Kommentar das Gedicht an Länge weit übersteigt, ein bisschen wie bei den Schriften der chinesischen Philosophie. Ich habe mich in meiner Leseerfahrung vollkommen von dem fiktiven Verfasser des Textes leiten lassen, der einem nebenbei bemerkt gleich zu Beginn empfiehlt, erst den Kommentar und danach erst das Gedicht zu lesen, auch wenn die Texte in umgekehrter Reihenfolge abgedruckt sind. Ähnlich, wie bei Lolita, interessiert mich der substantielle Inhalt des Geschriebenen wenig, er ist meiner Meinung nach bei Nabokov oft Nebensache, eine Leinwand, auf der das Virtuose seines Umgangs mit Worten wirken kann. Meine Eltern bezeichnen Nabokov als den wohl besten Stilisten der englischen Sprache und sind damit sicherlich nicht alleine, diesem Urteil würde ich mich mit der Vorsicht eines weitaus weniger belesenen Menschens ohne zu zögern anschließen. Alles, was Nabokov schreibt, beinhaltet in seiner Schönheit einen Detailgrad, der einem Gemälde von Hyronimus Bosch gleichkommt und gleichzeitig unendliche Eleganz und einen seidenen Fluss aufweist. Diese komplexe Schönheit steht dem Geschriebenen jedoch nicht im Wege, eine ganz unmittelbare Reaktion beim Leser hervorzurufen; sei es ein Lachen bei einem absurden Dialog zwischen Hauptbösewicht und exzentrischem Villabesitzer oder der zarte Schmerz des Herzens, beim nachempfinden einer unerwiderten Liebe, deren Unausweichlichkeit sich in zwei, drei Sätzen mit einer blendenden Klarheit entfaltet.
Häufig liegt das allgemeingültige Verständnis eines Autors oder Autorin als "groß" recht weit entfernt vom eigenen, subjektiven Empfinden dieser Künstler und Künstlerinnen. Doch die Einzigartigkeit von Nabokovs Art zu schreiben, die Tatsache, dass er sowohl die englische Sprache, als auch das Konzept des Kunstmediums Roman weit über seine bekannten Grenzen in die Ferne zuvor unvorstellbarer Schönheit getragen hat, lassen mich ausnahmsweise sehr einfach verstehen, warum dieser Mann als einer der "Großen" gelten muss, denn wer, wenn nicht er.
Normal People - Sally Rooney
Wie wahrscheinlich jeder Mensch, dessen Bild von der Welt über die tatsächlichen Verhältnisse seiner eigenen intellektuellen Fähigkeiten hinausgeht, tue auch ich mich häufig schwer, zeitgenössische Kunst, insbesondere Literatur ernst zu nehmen. Ich muss bei solchen Gedanken unweigerlich an eine Stelle aus Tolstois Krieg und Frieden denken, in denen sich der Autor über all jene lustig macht, die glauben, die Zeiten in denen sie leben würden sich auf eine bisher nie dagewesene Art und Weise von allen vorhergegangenen Zeiten unterscheiden. Meine naive und zugegebenerweise nicht gut durchdachte Auffassung, die gegenwärtige Literatur hätte mir nicht viel zu bieten, wurde im letzten Jahr allerdings mit einer emotional beinahe schmerzlichen Deutlichkeit widerlegt.
Ich habe den Sommer 2024 bei meinen Eltern in Bochum verbracht, in einer leicht zu romantisierenden Zeit zwischen Studiumsabschluss und Antritt der ersten Anstellung, welche auch als kurzfristige Arbeitslosigkeit bezeichnet werden dürfte. In diesen von beinahe sämtlichen Pflichten befreiten Wochen und Monaten hatte große Erwartungen an meine eigenen Lesekapazitäten, denen ich jedoch nicht ganz gerecht werden konnte. Ein Buch hat mich allerdings auf Anhieb derart für sich beansprucht, dass ich es binnen zweier Tage ausgelesen habe; nur der Schlaf teilte meine Leseerfahrung unweigerlich entzwei. Wie so viele andere Bücher, kam Normal People dan meiner Mama in meinen Besitz, wenige Wochen nach meiner Ankunft in der Heimat besuchten wir in vollem Bewusstsein der damit verbundenen Risiken ein Buchgeschäft und kamen, wie es auch nicht zu verhindern gewesen wäre, einige Kilogramm schwerer wieder raus. Ich erwähnte eingangs bereits meine Skepsis bezüglich beinahe allen Büchern, die als zeitgenössisch bezeichnet werden dürfen und so übte ich mich bezüglich meiner Erwartungen an Normal People in Vorsicht. Wie sich herausstellte, wäre vielleicht eine andere Vorsicht angemessen gewesen.
Normal People erzählt von einem jungen Mann und einer jungen Frau, die in Irland die Schule abschließen und anschließend die gleiche Universität besuchen; eine Ausgangssituation die erstmal zu viel Kitsch und einem Gefühl des Wiederkauens einlädt. Die tatsächliche Leseerfahrung könnte jedoch dessen nicht entfernter sein. Auf einem Buchrücken würde wahrscheinlich stehen (ich habe ihn natürlich nicht gelesen, siehe oben): ein Roman über persönliche Entwicklung und den Umgang mit komplizierten Gefühlen! Eine solche durch ihren inflationären Gebrauch vollkommen bedeutungslose Beschreibung würde nicht faktisch falsch sein, doch sie würde nichts von der Tiefe, der sanften Gewalt und der schmerzhaften Zerbrechlichkeit dieses Buches vermitteln. In Normal People lese ich das Austragen eines verzweifelten Kampfes zwischen Selbstwahrnehmung und unseren unbiegsamen, innersten, besten Gefühlen, für die wir uns nebenbei bemerkt nie schämen sollten, wie uns der Idiot von Dostojewkij lehrt. Für mich ist in Rooneys Buch viel Schmerz, der, so bilde ich es mir zumindest ein, vor einer Kulisse spielt, die so gegenwärtig wie organisch ist. Nichts in diesem Buch wirkt gestelzt, unerlebt, nur dem Zweck gewidmet einen Schein der Zeitgenössigkeit aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil, alles ist wirkt sehr nah: eben auch zeitlich.
Ich bin der Meinung, dass die großen Gefühle und Regungen des Menschen die Zeiten im Allgemeinen überdauern. Ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert mag verstauben und Risse bekommen, doch wenn vor hunderten Jahren ein Gefühl eingefangen hat, so wird es das für immer in sich behalten, wie in Harz gegossen. Ungeachtet dessen ist es auf eine besondere Art vertraut solche Gefühle auf einer Bühne dargestellt zu sehen, in der man tagtäglich lebt und die einem dadurch noch weniger als Bühne scheint. Normal People ist ein fantastisches Buch, das nur von einer fantastischen Autorin geschrieben werden konnte, wir haben lediglich zufälligerweise das Privileg, zur gleichen Zeit die Sonne sehen zu dürfen.
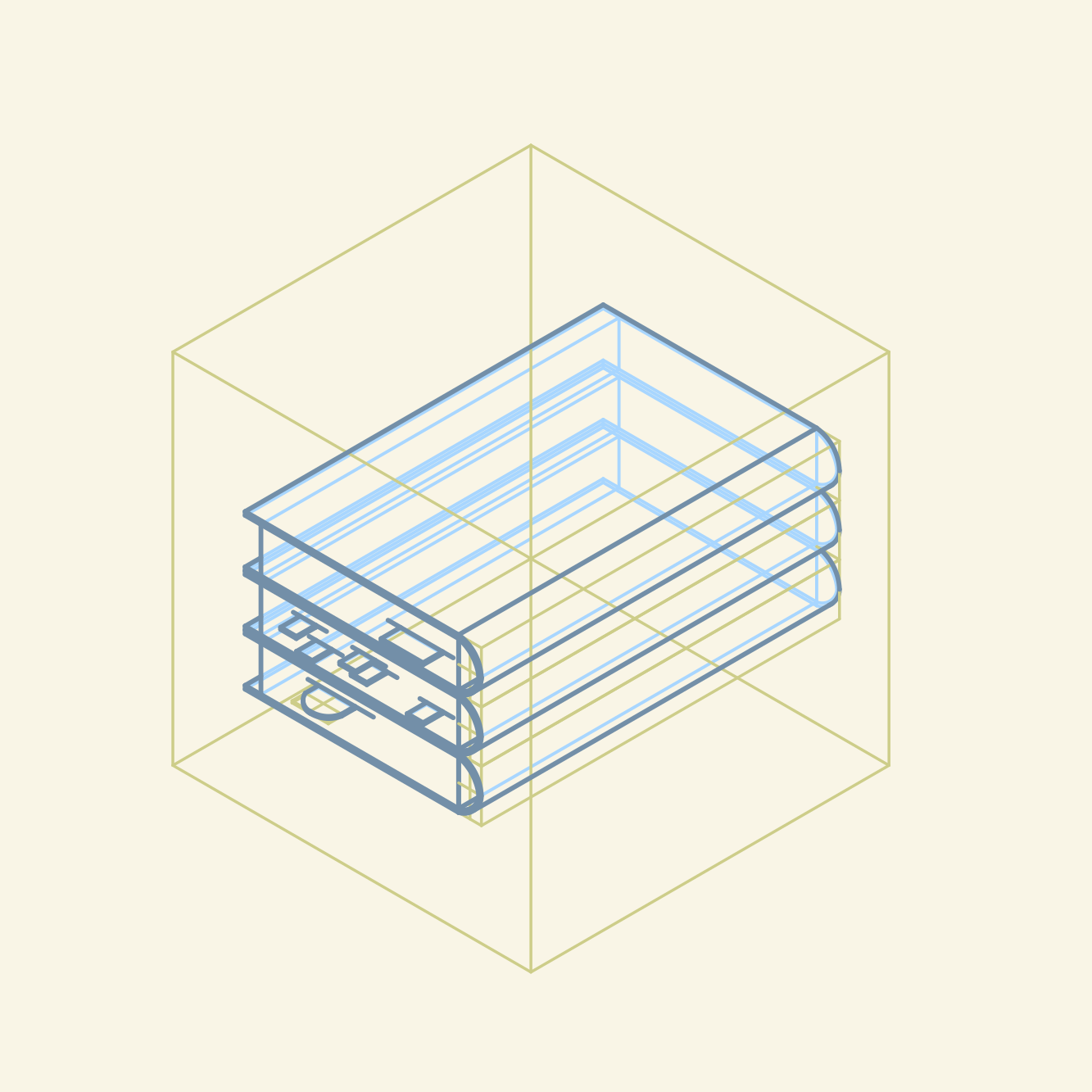
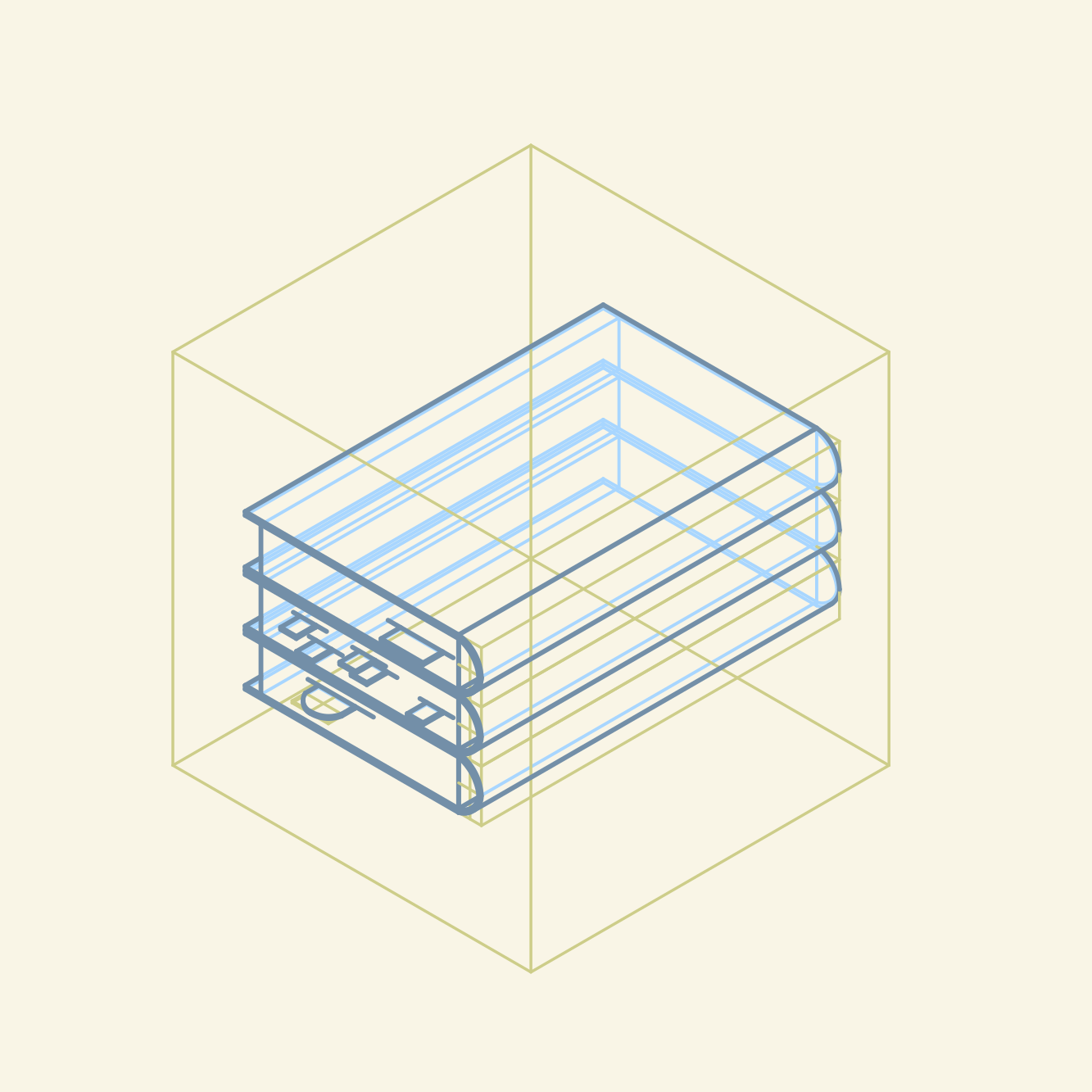
Evegnij Onegin - Alexander Puschkin
Nach Nabokov findet sich ein zweiter Vertreter der "großen" Literatur auf dieser Liste, und es ist wieder ein Russe, obwohl sich dieser meines Wissens nach in seiner Genialität auf die russische Sprache beschränkt hat: Evgenij Onegin ist, und das ist ohne mein Gepläkel offensichtlich, ein Werk, das einzigartig in seiner Schönheit und Bedeutsamkeit ist. Es ruft mir zudem mit besonderer Prägnanz in's Bewusstsein, wie dankbar ich bin, auch russische Literatur im Original lesen zu können - wie unermesslich viel Schönes mir sonst abhanden käme, alleine wenn ich dieses einzige Buch nicht lesen könnte!
Evgenij Onegin ist vollständig in Versen verfasst und ich, als absoluter Amateur hinsichtlich des gereimten Schreibens, kann nicht genug darüber schreiben, was für einen unvergleichlichen Klang Puschkins Verse haben, was für einen über allem schwebenden Fluss der Sprache dieser Mann erzeugen konnte. Als Kinder der Ukraine, und damit der ehemaligen Sowjetunion, sind meine Eltern mit Überbleibseln auswendig gelernter Gedichte ausgestattet, die sie vermutlich auch ohne ihr Germanistikstudium beibehalten hätten. Schon früh war mir Puschkin ein Begriff, und beinahe unverständlich früh habe ich die Schönheit seiner Sprache erkannt. Er bleibt bis heute der wohl einzige Dichter, in einer sehr überschaubaren Reihe der von mir gelesenen, dessen Werke ich mit unaufhörlicher Begeisterung lesen kann: keinem einzigen seiner Verse kommt seine unverwechselbare Melodie abhanden.
Während ich bei Nabokov in's Schwärmen über die Sprache und seine konzeptionellen Ideen bezüglich dessen, was ein Roman ist und wie er auszusehen hate, den Inhalt des Geschriebenen in den Hintergrund stelle, ist die Geschichte von Alexander Onegin so einprägsam und mitreißend, dass man sich ihres Eindringens in sein Herz garnicht wehren kann. Es ist die Geschichte eines, wie er in Diskussionen zu Literaturfigurstereotypen genannt wird, überflüssigen Menschen. Der Hauch von Willkür und Sinnlosigkeit treibender Schlüsselereignisse nehmen den fatalen Konsequenzen keinerseits ihre Tragik, sie bestärken sie sogar darin. Trotz der Vorsicht, die mir als Mann geboten ist, wenn es um die Beurteilung weiblicher Figuren geht, die von anderen Männern geschrieben sind, komme ich nicht umhin Tatjana als eine umwerfend starke Figur zu empfinden, die als wärmstes menschliches Licht in der landschaft von Unglückseligen brennt.
Wenige Wochen nach dem ich Onegin gelesen habe, bin ich in den Genuss gekommen in Düsseldorf die zu Tschaikovskis Musik inszenierte Oper zu dem Werk zu sehen. Der erste Opernbesuch meines Lebens, vor Jahren in Wien, ist erwartungsgemäß verlaufen: ein weiter, unüberwindbarer Graben spannte sich zwischen dem vorgehen auf der Bühne und meiner emotionalen Empfänglichkeit. Vollkommen anders war es jedoch bei Evgenij Onegin: die Bereicherung des Romaninhalts durch Tschaikovskis Musik, das Erleben der Operndarsteller auf der Bühne, die Vibration in der Luft ausgelöst vom Orchester im Graben, all das war eine grandiose Bereicherung. Noch nie zuvor habe ich erlebt, wie ein Werk aus einem Medium in ein anderes Medium gehoben wird und dabei eine solche Bereicherung bei Wahrung seiner ursprünglichen Form erhält.
Onegin birgt eine Tragik in sich, die beinahe alle Farbe und Hoffnung aus dem Lesenden zieht, wäre sie nicht in die mit schönsten Verse gebettet, die je ein Mensch zu Papier gebracht hat.
Die Schatten von Prag - Martin Becker und Tabea Soergel
Ich laufe häufig Gefahr mir selbst, auch in meiner Freizeit und meinen Hobbys, Dinge aufzubürden, alleinig aus der Ansicht heraus, dass mir diese Dinge zu gefallen haben. So ist meine Leseliste häufig von Literatur gefüllt, die aufgrund ihrer Bedeutungsdichte durchaus als schwer zu bezeichnen ist. Ich für meinen Teil brauche nach den schicksalhaften Ereignissen, denen das Umfeld Onegins ausgeliefert ist, einige Zeit, das Gelesene zu verdauen, nicht jeden Tag kann meine Seele den Zerreisproben solcher Literatur standhalten. Ich kann mein Herz nicht ständig auf den Seiten meiner Lieblingsbücher verteilen, ohne ihm die Chance zugeben, geheilt und ausgeruht in meine Brust zurückzukehren. Ohne das mit einem wertenden Unterton versehen zu wollen: manchmal brauche ich auch ein Buch, dem ich mein Herz nicht unwillentlich ausliefere, sondern das mich einfach gut unterhält.
Aufmerksam geworden auf "Die Schatten von Prag" bin ich bei einem spontaen Besuch in einer Stuttgarter Buchhandlung mit meiner Freundin?, bei dem ich mir natürlich fest geschworen habe, nichts zu kaufen. Wenn du das hier liest, habe ich abermals meine Prizipien verraten - die Welt ist ein unbeständiger Ort, die Beweggründe des Menschen unergründbar. Dem aufmerksamen Leser wird langsam ein Muster auffallen. Um bei Mustern zu bleiben: den Klappentext habe ich meine Freundin lesen lassen, um mir daraufhin ihr Urteil bezüglich der Kauffrage anhören zu können. Das Urteil war nicht ganz klar, aber von einem brisanten Unterton geprägt: Kafka als literarische Figur in einem Roman, der in Prag spielt! Das weckte Spekulationen und Erwartungen, und nicht nur Gute. Der Kauf des Buches wäre sicherlich ein Risiko, aber man lebt gelegentlich gefährlich.
Der Stadt Prag ist ein bescheidener, aber nicht unbedeutender Platz im Dickicht meiner Wahrnehmung vorbehalten. Meine Mama schwärmt seit Jahren von dieser Stadt, wie von keiner anderen und ich selbst durfte unlängst mit meinem besten Freund ein paar Tage dort verbringen. Ich habe Prag im Sommer erlebt und auch wenn es stellenweise doch ein wenig zu touristisch war, um irgendeine Art unkonstruierter Eindrücke gewinnen zu können, so ist die Idee von Prag, das mentale Bild, absolut faszinierend. Die Gebäude, der Fluss, die Brücken, die Gassen von Prag, der Anfang des 20. Jahrhunderts: eine Welt, in der ich mich mit leichter Freude kurz vor der manchmal stählernd erdrückenden und allzu gegenwärtigen Gegenwartverstecken würde. Die Kulisse von "Die Schatten von Prag" entsprach also genau meinem Geschmack und wenn das Buch nicht gut sein würde, würde es vielleicht dennoch ungewollt unterhalten.
Nach Lesen des Buchs kann ich bestätigen, dass es mich unterhalten hat, doch ich kann beruhigend hinzufügen, dass die Unterhaltung beabsichtigt und ganz im Sinne des Autorenpaars war. Ich würde den Autoren, bei aller Bescheidenheit meiner Sicht auf solche Dinge, keine stilistische Brillianz oder unvergleichlich lebhafte Figurenbedarstellung anrechnen, aber das entsprach auch weder meinen Erwartungen noch meinen Ansprüchen an das Buch. "Die Schatten von Prag" kann man wohl als Kriminalroman bezeichnen, in dem eine weitere historische Figur, Egon Erwin Kisch, die männliche Hauptrolle verkörpert. Die zweite, ebenso ermittelnde, Hauptfigur ist weiblich, und ich erlaube mir wiederholt eine gewisse Freiheit in meinen folgenden Beurteilungen: die Perspektive der Frau in diesem historischen Kontext, der stellenweise aktueller ist als manch einem lieb ist, spielt keine unbedeutende Rolle. Ohne behaupten zu wollen, dass es sich sonst immer anders verhält, fügt sich diese Thematisierung der Frau und ihrer gesellschaftlichen Rollen und Wahrnehmungen anhand der Protagonistin, sehr organisch in das Gesamtwerk. An keiner Stelle hat man das Gefühl, dass gesellschaftliche Stellungnahme als Selbstzweck, losgelöst vom Romangeschehen, ungekonnt und wie ein Fremdkörper in den Text gestopft wurde. Ich vermute mit aller vorurteilsbefreiten Vorsicht, dass wir das auch der Anwesenheit einer Frau im Autorenteam zu verdanken haben.
Kafkas Auftritte im Buch waren, entgegen Sorgen und Spekulationen seitens meiner Freundin und mir, geschmackvoll und in ihrem Umfang bescheiden. Man fühlt sich beim Lesen in eine andere Zeit versetzt, und behält bei allen Beschreibungen genug Raum, um Lücken mit romantisierten Vorstellungen füllen zu können. "Die Schatten von Prag" waren wirklich ein bisschen Urlaub für die Seele.
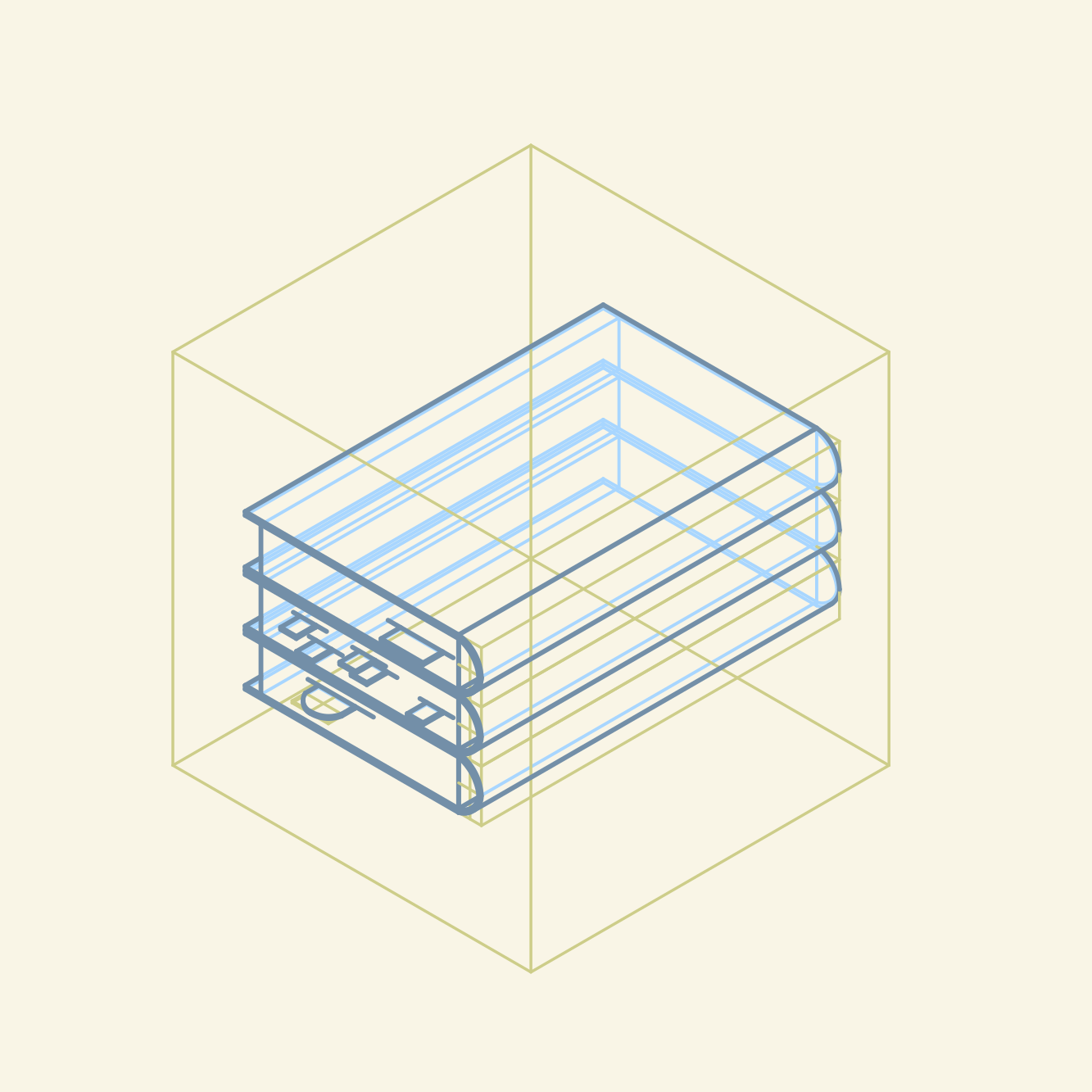
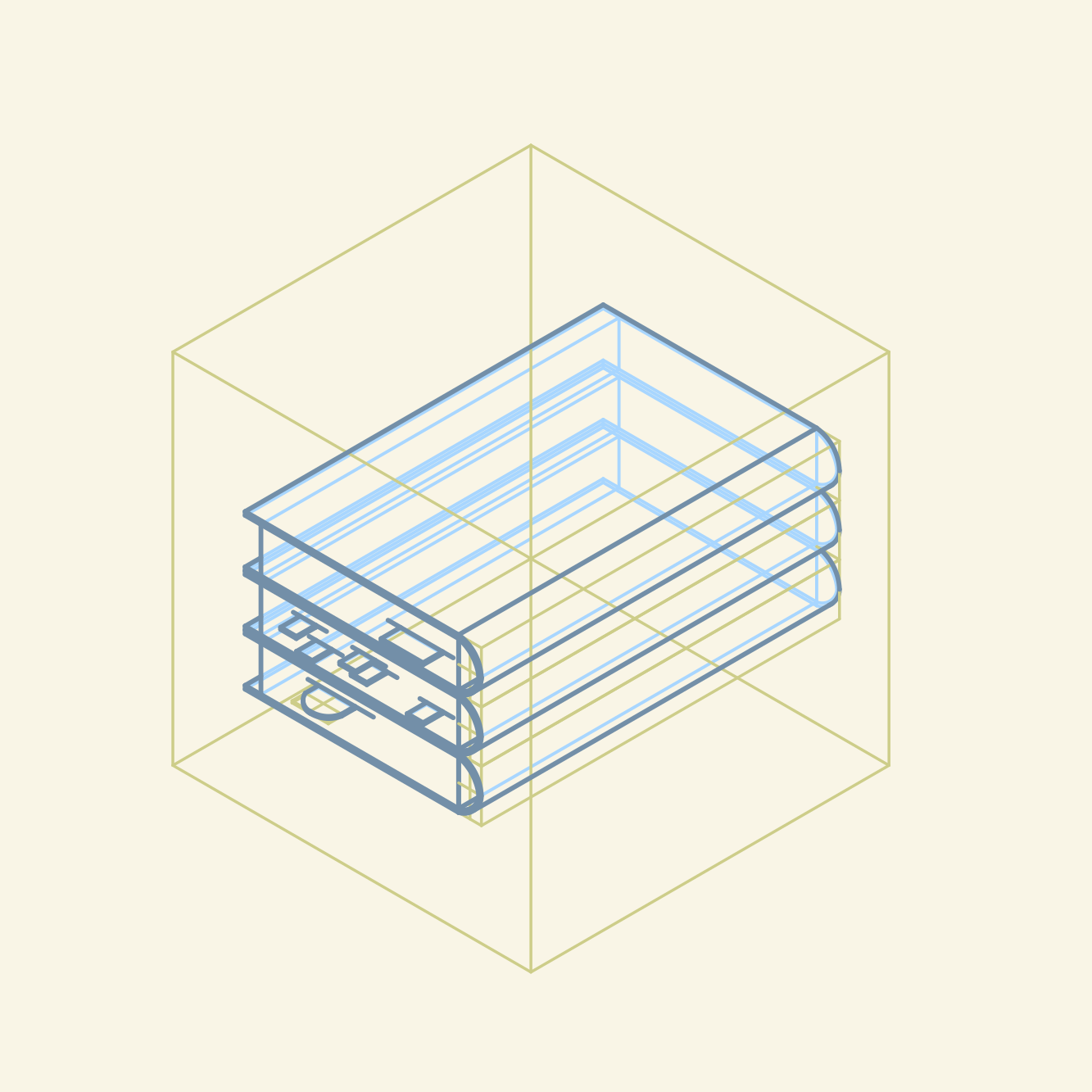
Das dreizehnte Kapitel - Martin Walser
Vor geraumer Zeit, jetzt schon einigen Jahren, stand ich in der Küche meines Elternhauses und ließ mich lächelnd von der Begeisterung mitreißen, die ein neues Buch bei meiner Mama ausgelöst hatte. Es handelte sich um einen Gedichtband von Martin Walser, der von seiner Tochter mit Aquarellen illustriert wurde. Eine Leidenschaft für Gedichte war in meinen Augen schon immer unzertrennlich mit einer mich einnehmenden Persönlichkeitsästhetik verbunden. Allerdings hatte ich bisher gedanklich deutlich mehr Zeit mit der Idee Gedichte zu mögen verbracht, als tatsächlich Gedichte zu lesen. Lieber ein Ideal unerkundet unbeschädigt lassen, als sich was Neues suchen müssen. Mit nicht allzu hohen Erwartungen an meine eigene Begeisterungsfähigkeit für das, was ich vorfinden würde, warf ich also einen Blick in den Gedichtband, den meine Mutter gekauft hatte. Es klingt vielleicht abgedroschen und unglaubwürdig, und vor allem als Einleitung zu diesem Paragraph wahrscheinlich sehr vorhersehbar, aber als ich beim zufälligen durchblättern des Bandes einzelne Zeilen las, hätte mich nichts auf den Sog vorbereiten können, dem meine Empfänglichkeit für Schönes auf einmal ausgesetzt war. Häufig kommt es mir so vor, als würde bei einem Gedicht der Versuch mit stählernem Griff die Bedeutung der Worte in die Form eines Verses zu drücken mehr beschädigen und versteifen, als dass er erschaffen kann. Vollkommenes Gegenteil bei Martin Walser: die Form, die seine Wortwahl, der Klang seiner Sprache zeichnet, ja wohl eher malt, ist untrennbar mit dem Inhalt vereint, ergänzt ihn, erhebt ihn in sonst unnerreichbare Sphären. Zart, in gewisser Weise leicht, ohne Gewicht zu verlieren. Der Reim ist bei Walser keine Dekoration, sondern unabdingbarer Teil des Kunstwerks. Seitdem habe ich mir Martin Walser als Autor abgespeichert, dem ich unbedingt mehr Aufmerksamkeit würde widmen müssen.
An meinem Geburtstag letztes Jahr, Ende August, habe ich dann dieses lang währende Vorhaben, eines unter zahlreichen, endlich umsetzen können. Ich bekam von meiner Mama "Das dreizehnte Kapitel" von Martin Walser geschenkt. Es handelt sich dabei um einen Briefroman bescheidener Länge, doch all die Gefühle, Regungen und Empfindungen die ich in meinem Unterbewusstsein in der Schublade "Walser" abgelegt hatte, entfalten sich wundersam auf seinen Seiten. Auch das dreizehnte Kapitel ist ein Buch, dass alleine durch seine sprachliche Ästhetik so besticht, dass ich beim darüber Scrheiben versucht bin seinen Inhalt nur wenig zu erwähnen. Ich habe bisher sehr wenig von Walser gelesen, aber das, was sein Schreiben für mich besonders macht, ist schwierig in eigene Worte zu fassen. Um mich bei den Umschreibungen meiner Mama zu bedienen: Walsers Schreiben ist außerordentlich fein und zart, so zart, dass ich Angst hätte es durch ungelenke Beschreibungen meinerseits zu zerbrechen. Ich wage trotzdem einen kurzen Kommentar: ich habe in den letzten Monaten einige Male darüber nachgedacht und bei größeren Geistern davon gelesen, dass die Darstellung von Menschen, egal in welchem Medium (malerische Kunst, Literatur...) am besten, oder vielleicht ausschließlich dann gelingt, wenn man nicht den Gegenstand selbst, also den Menschen selbst, sondern die Spuren, die er hinterlässt, künstlerisch verarbeitet. Zuletzt las ich diesen Gedanken wie widergespiegelt in einem Interiew Francis Bacons, einem meiner Lieblingsmaler. Wendet man diese Sichtweise auf Walsers Briefroman an, so zeichnet er das Bild zweier Menschen durch die leichtesten und zartesten Spuren, die jemand hinterlassen kann. Man darf sich jedoch von dieser vermeintlichen Zerbrechlichkeit nicht täuschen lassen; die Intensität und emotionale Farbenpracht dieser Spuren steht in keinem Verhältnis zu ihrer Scheinbaren Zartheit.
Der Briefwechsel, aus dem der Roman besteht, findet zwischen einem Mann und einer Frau statt, beide in ihren Feldern erfolgreich, beide romantisch anderweitig vergeben, beide glücklich. Nach einem zufälligen Kennenlernen, sofern man das erste persönliche Aufeinandertreffen dieser Figuren überhaupt so nennen darf, beginnt er Briefe zu schreiben, die in ihrem Ton den Eindruck eines beinahe unmissverständlichen Verrats seiner Partnerin erwecken müssten. Und tatsächlich ist später im Roman auch explizit von Verrat die Rede - doch begangen wird er eigentlich nicht so recht. Der Mann bekommt Antwort, von einer Frau, die ihrerseits weder sein noch ihr eigenes Handeln so recht einzuordnen weiß. Doch es entseht eine zarte Vertraulichkeit, die vielleicht nur dort fruchtbaren Boden findet, wo die Annäherung zweier Personen davon geprägt ist, dass sie eigentlich garnicht stattfinden sollte und schon garnicht in diesem Ton und unter den gegebenen Randumständen. Vielleicht sind Verbindungen zu Menschen, die in ihrem Tiefgang einzigartig sind, aber auch an nichts gebunden, weder an ein "soll" noch an ein Gegenteil davon, sondern existieren vollkommen außerhalb unserer internen Vorstellungen und Konventionen in der Landschaft unseres tiefsten Innern. Dort, wo wir nur sehr selten selbst Einblick erhalten, und fast immer nur durch Andere.